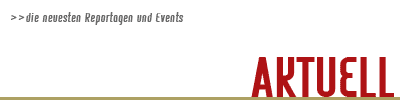
Dank an einen Hannoveraner
Deutschland auf einem neuen Weg
Im nachhinein ist das Wort "abenteuerlich" weitaus untertrieben, eine sanfte Warnung, die Freunde untereinander ja aussprechen können. Schon letztes Jahr klang Schröders Ablehnung in vielen amerikanischen Ohren eher mild. In der "New York Times" hingegen wurde Bush mit dem verrückt gewordenen Schiffskapitän der USS Caine verglichen - ein kaum versteckter Aufruf zur Meuterei.
Im Irak ist fast alles schiefgegangen, was nur hätte schiefgehen können. Selbst die Festnahme des Tyrannen, die man - so Hans Magnus Enzensberger - immer als Freudenmoment erleben sollte, wirkt jetzt getrübt. Die Bilder der Demütigungen, die wir bei Saddams Festnahme gerade noch akzeptieren konnten, erinnern uns jetzt an die unerträglichen Demütigungen, die anderen Irakern zuteil wurden. Damit droht das Ganze in einen Schlamassel der Gewalt zu gelangen, der Saddams Greueltaten fast relativiert.
Das banale Böse
Schockierend ist nicht wirklich die moralische Verruchtheit. Spätestens seit Hannah Arendt wissen wir, wie einfache Menschen zum Bösen geraten. Kriegszustände bieten immer Rahmen, in denen normale Menschen zu Grausamkeiten bereit sind, die sie kaum als Grausamkeiten erkennen - Grund genug, den Krieg als allerletzte Handlungsmöglichkeit zu betrachten. Dieses Beispiel des banalen Bösen anhand einiger Soldaten dürfte uns also wenig überraschen, wohl aber die Mischung aus Arroganz und Dummheit, mit der die Bush-Regierung ihre Aufgaben anpackt.
Schiere Lust auf Rechthaberei hätte das Verteidigungsministerium dazu verleiten müssen, besondere Anweisungen zu geben. Wollte Rumsfeld nicht etwa beweisen, daß ein schneller, sauberer, freundlicher Krieg doch möglich sei? Und hätte er angesichts internationaler Widerstände seine Soldaten nicht gerade deshalb zu besonderer Rücksichtnahme auf die Bevölkerung anhalten müssen?
Verachtung für internationales Recht
Statt dessen mehren sich täglich die Zeichen, daß die Anweisung zur Folter von immer weiter oben kam - keine Überraschung bei einer Regierung, die ihre Verachtung für internationales Recht nie verborgen hat. Also selbst die instrumentelle Vernunft hat hier versagt, so wie auch nur jedes weltöffentlichkeitsbewußte, PR-erfahrene Ohr. Die Berufung des Guantánamo-Chefs als Aufräumer für Abu Ghraib läßt Ahnungslosigkeit zu Kunst werden. Fehlte nur noch, daß die Regierung in diesem Augenblick versucht, ihren Soldaten mit Drohgebärden Straffreiheit vor dem Internationalen Gerichtshof zu verschaffen. Und die Tatsache, daß die Besatzungsmacht ihre Verzweiflung an ihrem einstigen Vorzeige-Iraker Chalebi ausläßt, zeigt uns eine Regierung, die in jeder Hinsicht überfordert ist.
Sein "Nein" zum Irak-Krieg
Wenn die Bundesregierung also recht hatte, wo bleibt hierzulande der Beifall? Rechthaberei, geschweige denn Schadenfreude wären fehl am Platz. Dafür ist die Lage zu bitter, zu ernst: Auch diejenigen, die vor dem Irak-Krieg warnten, werden von seinen Folgen bedroht. Deutschland könnte aber einen berechtigten Stolz auf seine Regierung empfinden als eine der wenigen, die früh den Mut hatten, Stellung zu beziehen.
Der Mythos, daß es sich dabei nicht um Mut, sondern um Opportunismus handelte, setzt sich in einem zynischen Zeitalter mühelos durch. Doch nicht erst Schröders "Nein" hat seine Umfragewerte verbessert, sondern die Tatsache, daß er bei der Dresdner Flutkatastrophe wie ein Kanzler wirkte, Stoiber dagegen wie ein hilfloser Oberschulmeister. Ob das allein gereicht hätte, die Wahlen zu gewinnen, werden wir nie erfahren.
Und dennoch wird Schröders Ablehnung des Irak-Kriegs als viel bedeutender angesehen, vor allem unter amerikanischen Meinungsträgern, die Deutschland als moralische Instanz gefeiert haben - zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte. "Sagt Schröder danke schön!" hörte ich oft in jenem Herbst, und: "Wenn die Europäer so weitermachen, dann könnten die uns retten."
Lob als Anbiederung
Hierzulande aber wird solcher Dank nicht ausgesprochen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen: Man geniert sich, eine Regierung, unter der man selber lebt, zu loben. Jeder Intellektuelle, der etwas auf sich hält, sieht sich als Kritiker der bestehenden Verhältnisse, und jedes Lob der Macht wird als Anbiederung empfunden. Den Mächtigen gegenüber nur die unangenehmen Wahrheiten auszusprechen dient wohl als Faustregel, doch hat diese - wie alle Faustregeln - ihre Grenzen: spätestens dann, wenn die Kritik so laut wird, daß das Kind mit dem Bade ausgeschüttet zu werden droht.
Aber ein einfacher Grund spielt wohl eine noch größere Rolle: Jede Regierung wird im Ausland nach ihrer Außenpolitik beurteilt, im Inland aber eben nur nach dem meist ökonomischen Kleinkram, der als Innenpolitik gilt. Nur in den größten Krisenzeiten neigen Menschen - ob in Boston oder Bremen - dazu zu überlegen, wie ihr Land von außen überhaupt wahrgenommen wird. Amerikaner, die in den Vereinigten Staaten wohnen, betrachten Bill Clintons Präsidentschaft als weitgehend gescheitert. Rechte haßten ihn als Repräsentanten der offenen Gesellschaft, die die sechziger Jahre mit sich gebracht hatten; Linke beschimpfen ihn als einen Liberalen, der nie in der Lage war, eine gerechte Sozialpolitik durchzufechten, sondern eher alle Prinzipien kompromittierte.
Da hat ein Land gelernt
Keine Gruppe von beiden aber bemerkte das symbolische Kapital, das Clinton für Amerika im Ausland anlegte. Denn er verkörperte jenen amerikanischen Traum, der auch intelligente Menschen fesseln kann: den Traum von einer Welt, in der jeder nur genug Intelligenz und Energie braucht, um von ärmsten Verhältnissen zum höchsten Amt zu gelangen. Mit seiner Wärme, Neugierde, Aufgeschlossenheit und Ungezwungenheit verkörperte Clinton alles, was man sich von der Neuen Welt erhoffte - eine Hoffnung, auf deren Grundlage man gar bereit war, von den Schattenseiten der amerikanischen Geschichte abzusehen.
Nur wenige Amerikaner merkten, wie sehr ihr Land von Clinton profitierte, denn von innen her gesehen zählten nur das Auf und Ab der kleinen Erfolge, die Kompromisse mit der Industrie, die Langeweile und die Enttäuschungen des politischen Alltags. So meinte man zum Schluß, die inhaltlichen Unterschiede zwischen Gore und Bush seien gering. Symbole werden am ehesten von weitem gesehen, und Kapital wird am ehesten dann vermißt, wenn es verbraucht ist.
Ein neues Deutschland-Bild
Alle Vergleiche sind ungenau. Doch stellt sich die Frage, ob den Deutschen bewußt ist, was die jetzige Regierung für Deutschland im Ausland vollbracht hat. Fischers Bemühungen im Nahen Osten und Schröders entschiedene Ablehnung des ungerechtfertigten Krieges sind nicht nur bekannt und geschätzt. Sie sind Ereignisse, die zu einem neuen Deutschland-Bild beitragen. Willy Brandts Kniefall war damals ein Anfang, doch nicht nur Deutschland sehnt sich nach Normalität.
Die Welt braucht ein Deutschland, das nicht nur seine Vergangenheit bereut, sondern aus ihr lernt. Die selbstbewußten und differenzierten deutschen Entscheidungen der letzten Jahren - vom Kosovo bis zum Irak - zeugen von einem erwachsenen Land, das gelernt hat, sowohl politisch als auch moralisch zu handeln.
Dabei wird es auch ein Vorbild für jene, die sich - wie in Israel oder Amerika - Deutschland vor kurzem noch lediglich als Heimat des Schreckens vorstellen konnten. Die Wandlung, die dabei stattfindet, ist keine Folge der Zeit, sondern eindeutiges Verdienst dieser Regierung. Es fragt sich nur, ob dieser Verdienst zu Hause erst dann geschätzt werden wird, wenn seine Urheber schon wieder entmachtet in der Plathnerstrasse ihrem Ruhestand fröhnen.
(wsi)